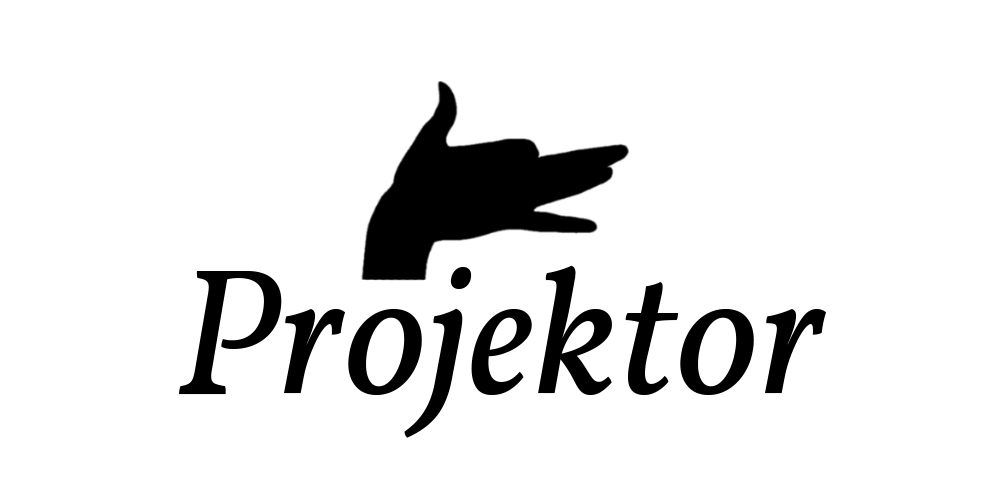Parallel zum Coronavirus hat sich eine Pandemie der Einsamkeit auf dem Globus ausgebreitet. Die Isolation, die erschöpfende Gleichförmigkeit und Existenzängste, die unser Leben derzeit bestimmen, greifen die Psyche genauso an, wie das Virus den Körper und hinterlassen ähnlich tiefe Spuren in uns, körperlich und geistig. Psychische Traumata können sich in dieser Situation dadurch schnell verschlimmern. Einen Impfstoff gibt es dafür nicht: Weder die Welt um uns herum, noch unsere Psyche sind bisher vollends erschlossen. Die Antworten der Wissenschaft scheinen zu versagen. In dieser Welt, die keiner erkennbaren Logik folgt, sind wir der Willkür der Natur unterworfen – innerlich wie äußerlich.
Gerade in diesen Zeiten lohnt es sich, auch in der Kunst nach Antworten zu suchen, die nicht nur Trost spendet, sondern unserem Dasein einen Sinn jenseits der Wissenschaft aufzeigen kann. Der britische (Drehbuch-)Autor und Regisseur Alex Garland möchte mit seinem Film Annihilation (2018) nicht die ersehnten Antworten geben. Er sucht stattdessen nach Wegen, mit der Ohnmacht gegenüber den Naturgewalten zurecht zu kommen.
Science-Fiction und Existentialismus
Diese existentialistische Weltanschauung wird in den Filmen Garlands wiederholt aufgegriffen, indem er stets den Kampf des menschlichen Daseins mit der übrigen Welt darstellt: In seinem Drehbuch für den Zombiefilm 28 Days Later (2002) wird der Mensch dem Instinkt unterworfen. In Ex Machina (2014) widmet er sich der Überholung des Menschen durch seine eigene Schöpfung, einer Künstlichen Intelligenz, und in der Sci-Fi-Serie Devs (2020) nimmt eine Maschine, die alle zukünftigen Prozesse deterministisch vorausberechnen kann, jede Hoffnung auf einen Freien Willen. Nicht zuletzt stellt in Garlands Skript zu Sunshine (2007) besonders plakativ die Sonne den Antagonisten: Der sterbende Stern soll vor dem Erlöschen bewahrt werden – mithilfe einer Superbombe. Die letzte Schlacht der Menschheit wird hier mit der Natur ausgetragen.
In Annihilation (2018) findet das Ringen um die Bedeutung des menschlichen Daseins ihren Höhepunkt. Ein Dasein in der Gewalt einer unerklärlichen, übermächtigen Natur. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch des US-Autors Jeff VanderMeer und ist der erste Teil dessen Southern Reach Trilogie. Wie bei Garland steht das Dasein für VanderMeer in einem Spannungsverhältnis zwischen Psyche und Natur. Den Konflikt des Menschen mit der äußeren und seiner inneren Natur inszeniert Garland in einem Setting, das beide Aspekte zum Vorschein bringt: Der Großteil der Handlung von Annihilation spielt sich im “Schimmer” ab: Ein von der Regierung abgeriegeltes Gebiet, in dem Fauna und Flora in unerklärlichen Weisen mutiert sind. Mehrere militärische Expeditionstrupps verschwinden im Inneren des Schimmers auf unerklärliche Weise, bis eines Tages der Soldat Kane als einziger Überlebender zurückkehrt. Seiner Ehefrau Lena gegenüber verhält er sich seltsam und als sich sein körperlicher Zustand verschlimmert, entschließt sich Lena, die selbst Biologin ist, für eine Mission in den Schimmer. Dort will sie nach Antworten auf die rätselhaften Vorgänge suchen. Begleitet wird sie von einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen. Obwohl sich alle fünf Frauen der immensen Gefahr bewusst sind, sind sie zunächst entschlossen, das Zentrum des Sperrgebiets zu erreichen. Ihr konkretes Missionsziel bleibt unklar – es scheint sich sogar von Teammitglied zu Teammitglied zu unterscheiden.

Natur, die oberste Gewalt
Voller unerklärlicher Geheimnisse und Gefahren wirkt der Schimmer wie eine Miniaturversion des übermächtigen Kosmos. Er dehnt sich unaufhaltsam aus und befällt und verändert dabei alles Leben in seinem Umkreis, scheinbar ungerichtet. So muss sich auch die kleine Truppe den äußeren Naturgewalten stellen: Den Angriff eines riesigen Alligators überleben sie nur knapp. Eine der Frauen fällt einer mutierten, bärenhaften Kreatur zum Opfer. Daraufhin verliert eine weitere den Verstand und wird kurz darauf ebenfalls von der Kreatur umgebracht. Den Urgewalten der Natur hat der Mensch hier weder körperlich, noch geistig etwas entgegenzusetzen.
Die Reise durch Garlands Schimmer ist gleichzeitig eine Reise in das Innere des Menschen und zeigt, wie auch dort die Natur über das Dasein herrscht. Die Teamführerin Dr. Ventress trägt einen tödlichen Tumor in sich – Wucherung und willkürliches Wachstum innerhalb des Körpers. Des Weiteren haben alle Teammitglieder ihre eigenen psychischen Lasten zu tragen: Die Geomorphologin Sheppard hat ihre Tochter verloren. Lena, die heimlich ihren Ehemann betrogen hat, wird von Schuldgefühlen zerfressen. Das Verhalten der anderen Mitglieder, wie Sucht und Selbstverletzung, zeugen von Leid und Trauma – Folgen sinnloser Schicksalsschläge des Daseins. Josie, die Physikerin des Teams, verbirgt unter langen Ärmeln die Narben ihrer Selbstverletzung.
Nach dem Tod der ersten zwei Teammitglieder sitzen Josie und Lena gemeinsam auf einer Blumenwiese. Grüne Keime ziehen sich durch ihre Venen und sprießen aus Josies vernarbten Unterarmen, als diese zugibt, dass sie den Schimmer weder bekämpfen, noch ihm ins Auge sehen will. Dann verschwindet sie im Dickicht. Josie ergibt sich dem Schimmer und wird zum Bestandteil des psychedelischen Ökosystems.

“Das Dasein ist dem Werden, dem Entstehen und Vergehen unterworfen und als etwas Veränderliches anzusehen.”
So fasst der Literaturwissenschaftler Sascha Seiler Hegels Verständnis von Dasein zusammen. Hier wird der erste Aspekt von Garlands Auseinandersetzung mit dem menschlichen Dasein sichtbar: Die Natur in Annihilation, repräsentiert durch den Schimmer, definiert sich durch Entropie, Willkür des Schicksals und endloses Wachstum. Obwohl der Mensch auf der Suche nach Sinn ist, kann er sich dem universellen Chaos (und dem damit verbundenen Leid) nicht entziehen. Er muss sich den zerstörerischen Prozessen der Natur – und deren Unbegreiflichkeit – unterwerfen und wird dabei selbst Teil der Veränderung.
Mensch vs. Selbst
Lena erreicht das Zentrum des Schimmers alleine. Der Leuchtturm, den sie vorfindet, ist der Endpunkt ihrer Reise und wird implizit als Ort der Offenbarung verstanden. Die einleuchtende Metaphorik trügt jedoch: Im Turm wartet keine Antwort oder absolute Wahrheit auf Lena. Stattdessen findet sie unter dem Turm eine Höhle vor, in deren Zentrum eine abstrakte geometrische Form schwebt, schillernd und pulsierend. Diese ließe sich vielleicht durch mathematische Formeln beschreiben, nicht aber mit Worten. Aus der Form wächst eine Gestalt heraus, die Lenas Bewegungen imitiert, sie körperlich dominiert und sich im Verlauf der Szene zu ihrem Ebenbild verwandelt.
Hier zeigt sicher zweite Aspekt von Annihilation‘s Auseinandersetzung mit dem Dasein: Die Begegnung des Menschens mit seiner eigenen Natur. Der Leuchtturm und die Höhle fungieren hier wieder als Sinnbilder für den Eintritt in das eigene Bewusstsein, beziehungsweise Unterbewusstein. Ihrer exakten Kopie gegenüberstehend, stellt sich Lena in gewisser Weise einem Teil ihrer fragilen Psyche – dem Teil, den sie zugleich fürchtet und verabscheut. Sie wird aufgrund ihrer Affäre offensichtlich von Schuldgefühlen gegenüber Kane geplagt. Einerseits möchte sie durch die aufopfernde Mission im Schimmer wohl wiedergutmachen, was sie ihrem Partner angetan hat. Andererseits ist es aber auch naheliegend, dass sie im Schimmer nichts Anderes als die von Schuld befeuerte Selbstzerstörung sucht. Die Filmkritikerin Angelica Bastién beschreibt die fremdartige Erscheinung im Leuchtturm als „physical embodiment of her [Lena’s] self-destructive nature and depression“. Diese Interpretation ist nicht weit hergeholt: Das Wesen als Verkörperung dieser Schuldgefühle schlägt Lena nieder und erdrückt sie anschließend fast.

“Die Existenz geht der Essenz voraus”
Lena trifft eine Entscheidung, vielleicht um ihrer scheinbaren Ohnmacht zu trotzen oder aber, um sich von ihrer Schuld zu lösen: Sie vernichtet die Kreatur mit einer Phosphorgranate und zerstört damit nicht nur den Schimmer, sondern womöglich auch das, was sie in ihrer Persönlichkeit als krankhaft und wuchernd sieht. Dieser Logik folgend, löscht sie ihr altes Selbstbild aus, um als neue Person daraus hervorzugehen und in die äußere Welt zurückzukehren. Sie wählt dabei einen anderen Weg als zuvor Kane, der sich im Leuchtturm selbst mit dem Brandsatz getötet hat und von dem nur das (womöglich geläuterte) Ebenbild zurückkehrt. Zwei unterschiedliche Ansätze, die eigene Identität mit ihren psychischen Lasten hinter sich zu lassen?
Antworten auf diese Fragen bietet womöglich eine Grundannahme des Existentialismus, der Annihilation philosophisch rahmt. Sartre schreibt in Ist der Existentialismus ein Humanismus?, dass die Existenz der Essenz vorausgehe. Was das heißen soll?
“Es bedeutet, dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht und sich danach definiert.”
Bevor der Mensch also über Begrifflichkeiten und Identitätszuschreibungen definiert werden kann, existiert er zunächst einfach. Zunächst kennt er nur sich selbst: Die eigenen Bedürfnisse und Schmerzen. Dann beginnt er auf seinem Weg durch die Welt, sich selbst von seiner Umwelt abzugrenzen und Beides nach logischen Maßstäben zu definieren. Die Erfahrungen, die ihm zuteilwerden, versucht der Mensch in einen höheren Sinn einzuordnen und schustert sich dabei eine Identität zusammen.
Lena kehrt im Leuchtturm zu ihrer bloßen Existenz zurück. In der Begegnung oder Konfrontation erhält sie die Chance, ihre Identität neu zu finden – auch weil sie sich damit von ihrem bisher aufgebauten Welt- beziehungsweise Selbstbild lösen muss. Doch an diesem Punkt hält sie nichts mehr zurück: Die nüchterne Wissenschaft hat sie auf ihrer Reise durch den Schimmer zurückgelassen. Und auch Schmerz und Schuld führen sie an einen Endpunkt mit nur zwei möglichen Ausgängen: Entweder sie zerbricht an der Konfrontation oder geht daraus als neuer Mensch hervor.
Das Identitätskonstrukt überwinden
Nachdem sie aus dem Schimmer zurück ist, wird Lena einer Befragung unterzogen. Der Versuch, die Vorgänge im Leuchtturm und ihre Verwandlung in Worte zu fassen, muss unvermeidlich scheitern: Der Interviewer klammert sich an die Begrifflichkeiten eines Rationalismus, der vor der alles durchdringenden und vernichtenden Natur versagt, wie Lena und ihr Team es selbst erlebt haben. Seine Fragen veranschaulichen die menschliche Tendenz, jegliches Phänomen kategorisieren und beherrschen zu wollen. Das Fatale daran: Eingrenzende und potentiell selbstzerstörerische Identitätskonstrukte werden dadurch nur begünstigt. Lena, die sowohl mit der Unbegreiflichkeit der natürlichen Un-Ordnung, als auch mit den Untiefen ihrer eigenen Psyche konfrontiert wurde und darin ihre Befreiung fand, hat aufgehört, in derartigen Kategorien zu denken.
Das, was von ihr zurückkehrt, ist nicht die von Schuld geplagte Naturwissenschaftlerin, als die wir Lena zu Beginn des Films kennenlernen. Die letzte Szene bestätigt das: Ein Gespräch mit Kanes Doppelgänger, in dem beide zugeben, nicht mehr die Menschen zu sein, die sie zuvor waren. Sie scheinen sich von der vorgefassten Vorstellung, wer oder was sie zu sein haben, um ihrem Dasein Sinn zu verleihen, gelöst zu haben. In der letzten Einstellung des Films zeigt die Kamera Lenas Iris, in der die schillernden Farben des Schimmers leuchten. Dieses Bild offenbart endgültig: Lena hat den Schimmer in sich aufgenommen. Anstatt krampfhaft zu versuchen, die Welt zu erklären, hat sie die Herrschaft der Natur akzeptiert. Gleichzeitig spiegelt sich in ihrem Äußeren, dass Lena sich auch innerlich verändert hat. Sie ist ein neuer Mensch und trotzdem für immer von den Spuren des überwundenen Traumas gezeichnet.

Selbstaufgabe = Befreiung?
Garland demonstriert damit, dass es keinen allgemeingültigen Sinn gibt – nur die Natur in stetiger, unvermeidlicher Veränderung, Zerstörung und Erneuerung. Annihilation veranschaulicht anhand von Lenas Reise durch den Schimmer, dass die Natur keine Antworten bereitstellt. Sie ist die oberste Gewalt und wir müssen lernen uns anzupassen und an ihren Herausforderungen zu wachsen, um in ihr nicht unterzugehen. In der Erkenntnis, dass wir der Willkür der Natur unterworfen sind, liegt aber auch eine selbstermächtigende Kraft: Für ein erfülltes Dasein sind wir nicht mehr auf einen vorgeschriebenen Sinn angewiesen. Die Identitäten, die wir für uns konstruieren und über die wir uns definieren, können zwar helfen, mit den Höhen und Tiefen unseres Daseins zurecht zu kommen – Aber sie engen uns vor allem ein. Lenas Weg zeigt eine alternative Möglichkeit auf, mit psychischer Last umzugehen. Die eigenen Erfahrungen, Schuldgefühle und selbstauferlegten Definitionen hinter sich zu lassen, ist weniger ein tragischer Identitätsverlust, als vielmehr eine Befreiung, die es möglich macht, unser Dasein ganzheitlicher zu akzeptieren: Auch die Seiten, die wir nicht verstehen, Seiten, die nicht in das konstruierte Selbstbild passen und Seiten, die wir deswegen gelernt haben zu fürchten und zu hassen. Ein Dasein im Einklang mit den Gezeiten der Natur mildert die Furcht vor der Auslöschung des Alten aufgrund der bittersüßen Erkenntnis, dass zugleich etwas Neues an dessen Stelle tritt – oder wie Schiller schreibt:
“Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,
Und neues Leben blüht aus den Ruinen.”