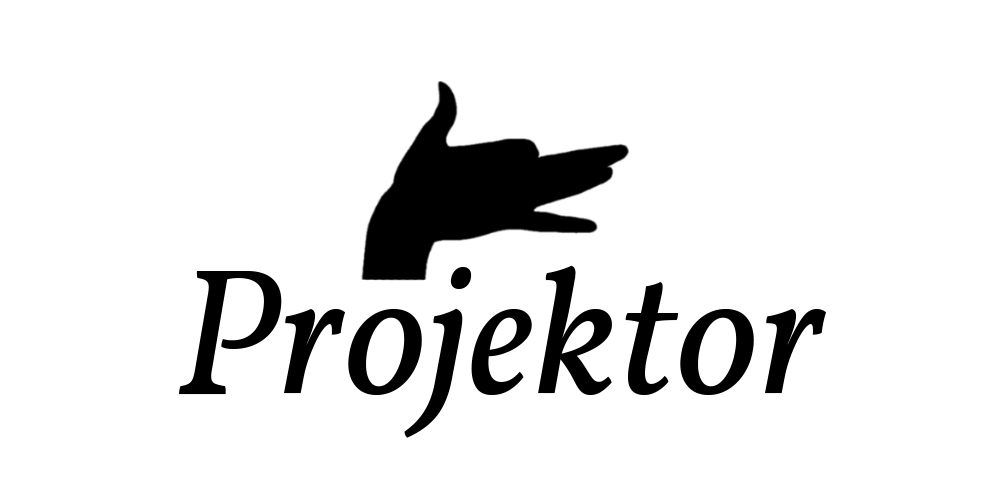Zehntausende Gelbwesten marschieren durch Paris, sie fordern den Rücktritt Macrons. In Chile kämpft die Bevölkerung gegen das Erbe des Pinochet-Regimes. US-amerikanische Statuen werden niedergerissen. Separatisten in Katalonien. Stuttgart 21. Black Lives Matter. Bei jeder größeren politischen Protestaktion der letzten Jahre konnte ich live dabei sein. Ich konnte mir ohne merkbare Verzögerung ein eigenes Bild der Lage schaffen – über Twitter, in Schalten von Fernsehsendern und über Live-Videos von Journalist*innen, die sich dort aufhielten. Inzwischen eine Selbstverständlichkeit.
Doch es gab auch Zeiten, in denen diese Selbstverständlichkeit undenkbar war. Mich interessiert: Wie würde ich ähnliche Aufnahmen aus einer ganz anderen Zeit wahrnehmen? Als man Monate bis Jahre warten musste, um politische Events visualisiert zu sehen.
Um diese Frage beantworten zu können, habe ich mir drei Dokumentarfilme angeschaut, die Original-Aufnahmen aus der Russischen Revolution 1917 verarbeiten. Die Filme sind: „Годовщина революции“, zu deutsch: Der Jahrestag der Revolution. Er zeigt die Februarrevolution mit einem Jahr Abstand. Dann „Падение династии Романовых“, zu deutsch: Der Fall der Romanov-Dynastie, der 10 Jahre nach der Revolution herauskam. Und zuletzt „От Царя к Ленину“, zu deutsch: Vom Zar zu Lenin, der 1937, also 20 Jahre nach der Revolution in die Kinos kam.
Beim Schauen habe ich drei Dinge gelernt. Nicht nur über die mediale Verarbeitung von Revolutionen, sondern auch wie wir die Russische Revolution wahrnehmen. Und über Geschichte an sich.
Eine kurze Geschichtsstunde
Um die Filme zu verstehen, muss man jedoch erstmal den historischen Kontext kennen.
Die Russische Revolution besteht aus zwei verschiedenen Revolutionen: Der Februarrevolution und der Oktoberrevolution, beide fanden 1917 statt. Bei der Februarrevolution rebellierte das Volk gegen den Zaren und seine Unterdrückung der Demokratie. Die Bauern besaßen kein eigenes Land und lebten in existentieller Armut. Arbeiter*innen in den Städten hatten nicht genug Nahrung, um zu überleben.
Außerdem führte der Zar, Nikolaus der Zweite aus der Romanov-Dynastie, Russland in den bis dato brutalsten Krieg: Den Ersten Weltkrieg. Von 1914 an kämpfte das Russische Zarenreich an Seite der Alliierten gegen die Mittelmächte, unter anderem gegen das Deutsche Reich.
Aufgrund dieser Unzufriedenheiten kam es in der damaligen Hauptstadt, Petrograd, heute St. Petersburg, zu Aufständen. Die Revolution endete erfolgreich; Grundrechte wurden eingeführt, Großgrundbesitzer enteignet und eine demokratische Regierung gegründet.
Doch der Krieg ging weiter, der Hunger hörte nicht auf. Und im Parlament kämpften zwei Parteien, die Bolschewiki und die Menschewiki um die Macht. Die Oktoberrevolution verhalf ersteren zur Macht: Unter dem Banner Lenins stürzte das Volk die damalige Regierung und installierte eine kommunistische Räterepublik. Die Bolschewiki, die kommunistische Partei, kam an die Macht und schloss Frieden mit den Mittelmächten. Nach einem mehrjährigen und äußerst brutalen Bürgerkrieg zwischen Monarchisten und Kommunisten wurde dann 1922 offiziell die Sowjetunion gegründet.
Genug Geschichte? Finde ich auch. Deshalb schauen wir uns jetzt die Filme an.
„Годовщина революции“

Ein Jahr nach den Ereignissen der Revolution kam „Годовщина революции“, der Jahrestag der Revolution, in die russischen Kinos. Der Film ist, ebenso wie die zwei Folgenden, ein Stummfilm. Die gezeigten Bilden werden mithilfe von Texttafeln eingeordnet. Zusammengeschnitten wurden die Aufnahmen von Dziga Vertov. Wer die Aufnahmen gefilmt hat, ist, wie bei den anderen beiden Filmen, unklar.
„Годовщина революции“ wirkt dabei wie eine nachrichtenhafte Zusammenstellung der Ereignisse. Kein Zwischenschritt der Revolution wird ausgelassen. Wir sehen: Den ersten Weltkrieg, politische Versammlungen, erste Diskussion im noch jungen Parlament, Wahlkampfveranstaltungen, Trauermärsche, Friedensverhandlungen und Brandreden. In dieser Detailverliebtheit findet sich die große Stärke des Films: Das Gefühl einer Massenbewegung kommt auf.
Der Zweck des Films sollte wohl genau diese Informationsverbreitung sein: Die Botschaft der Revolution musste, in einer Zeit, in der Zeitungen, Bücher und andere Videodokumente nur spärlich zugänglich waren, unter das Volk gebracht werden. Dutzende Kopien des Films wurden in die entlegensten Winkel Russlands geschickt.
Dabei wirkt Vertovs Dokumentation kaum gefiltert: Eine Pro-Sowjetische Haltung ist durchaus vorzufinden, trotzdem erzielt der Film den Eindruck einer authentischen und objektiven Informations-Wiedergabe.
Der heutigen Zuschauerschaft mag das ein wenig befremdlich erscheinen: Oft konnte ich Zusammenhänge nicht nachvollziehen, manchmal bekam ich das Gefühl, der Film verliere sich in unwichtigen Nebenschauplätzen.
„Падение династии Романовых“

Für „Падение династии Романовых“, der Fall der Romanov-Dynastie, müssen wir zehn Jahre in die Zukunft reisen, ins Jahr 1927. Inzwischen ist die Sowjetunion ein stabiler eigener Staat. Anders als bei „Годовщина революции“ spürt man die propagandistische Vereinnahmung durch die Regierung. Trotzdem bietet der Film einen neuen Einblick in die Revolution. Dabei versucht der Regisseur, Esfir Shub, die Geschehnisse von 1913 bis zur Februarrevolution chronologisch zu begleiten.
Gerade die erste Hälfte des Films ist verworren erzählt, ich konnte der Chronologie nur selten folgen. Im letzten Viertel nimmt der Film dann doch an Schwung auf. Wenn riesige Menschenmassen gegen das Zarentum demonstrieren, bekommt man das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Trotz der propagandistischen Natur des Films bekommt man in diesen Minuten einen authentischen Eindruck in das Petrograd von 1917.
Wenn am Ende des Films zu “Die Internationale” Lenins Reden in vollem Pathos gezeigt werden, dann entfaltet sich noch einmal ein ganz anderes Bild der Revolution: Eines, dass den Zuschauer beeindrucken und bewegen soll. Bei mir zumindest schafft es das auch.
„От Царя к Ленину“

1937 erschien „От Царя к Ленину“, zu deutsch: Vom Zar zu Lenin. Herman Axelbank, der Regisseur des Films, war ein in den USA lebender Exil-Russe. Der Film punktet durch einen Sprecher, der die Texttafeln ersetzt: Dadurch wird es leichter gemacht, in eine andere Zeit zu versinken.
Der Film sollte dem amerikanischen Publikum die Russische Revolution näherbringen. Jedoch löste er Kontroversen um die positive Darstellung Leon Trotskys, eines in Ungnade gefallenen Revolutionärs, aus. Nach Drohungen der sowjetischen Regierung trauten sich kaum noch Kinos “От Царя к Ленину“ zu spielen. Erst in den 70er-Jahren wurde der Film von amerikanischen Sozialisten in die Kinos gebracht.
Dabei ist diese Dokumentation äußerst lehrreich; ich konnte die Zusammenhänge zwischen den Archivbildern verstehen und fassen. Der Sprecher ordnet die gezeigten Szenen historisch und in den Kontext der Revolution ein, was mir beim Schauen eine klare und angenehme Orientierung gibt.
Das Pathos bleibt auch hier nicht aus: Wenn die Revolutionäre, von triumphaler Musik untermalt, die Regierungsgebäude umstellen, dann wird der Enthusiasmus der Demonstranten eindrucksvoll durch den Bildschirm hindurch transportiert. Die Menschenmassen sind in ihrer schieren Größe beeindruckend. Wenn sie bemerken, dass sie gefilmt werden, lachen und winken sie der Kamera zu. Ein schöner Touch, der die demonstrierenden Massen individualisiert und humanisiert.
Nachdem ich diese drei Filme gesehen haben, sind mir nach und nach drei Lehren klar geworden. Beginnen wir am Anfang.
Lehre Nummer 1: Weniger Quellen heißt mehr Propaganda
Aber Propaganda heißt nicht immer staatliche Propaganda.
Während Dziga Vertov „Der Jahrestag der Revolution“ zusammenschnitt, war die Sowjetunion bei weitem nicht stabil genug, um filmische Zensur wirkungsmächtig umsetzen zu können. Der Regisseur von “Vom Zar zu Lenin” war ein in den USA lebender Exil-Russe. Bei beiden Filmen kann man davon ausgehen, dass sowjetische Zensur nicht stattgefunden. Nur bei „Der Fall der Romanov-Dynastie“ könnte staatliche Zensur der Sowjetunion eine Rolle gespielt haben. Es ist jedoch schwer nachzuvollziehen, an welchen Stellen und in welchem Maße.
Trotzdem sind die drei Filme keine neutralen Berichterstattungen der Revolution. Alle drei Regisseure waren überzeugte Verfechter der Bolschewiki. “Vom Zar zu Lenin” endet mit einer mehrminütigen Rede Lenins, auf die das Volk mit Jubel reagiert. „Der Jahrestag der Revolution“ lässt die Revolution wie eine friedliche Machtübergabe aussehen. Und „Der Fall der Romanov-Dynastie“ schneidet minutenlang zwischen dem Prunk des Adels und der Misere der Arbeiter*innen vor der Revolution.
Wo wir schon bei Bildern sind: In allen drei Dokumentationen kommen zum Teil die gleichen Aufnahmen vor. Die wenigen visuellen Quellen, die es bei der Russischen Revolution gab, machen sich bemerkbar. Wir sind den unbekannten Kameraleuten ausgeliefert.
Das bedeutet auch, dass die hässlichen Seiten der Revolution nur spärlich gezeigt werden: Tote, Morde, Zivilisten, die an die Brutalität des Staates glauben müssen. Einzig “Vom Zar zu Lenin” zeigt getötete Demonstranten, die anderen Filme sind nahezu frei von Gewalt. Dadurch wirkt die Revolution deutlich zahmer als sie es tatsächlich war.
Außerdem habe ich keine Möglichkeit, herauszufinden, ob die gezeigten Bilder nicht völlig aus dem Kontext gerissen wurden. Gerade gesprochenes Wort, welches nur in Texttafeln bzw. nachsynchronisert stattfindet, könnte ohne Mühe verfälscht worden sein.
Doch selbst wenn dies nicht der Fall wäre: Die Originalaufnahmen der Revolution brauchen eine Einordnung, um als Dokumentation zu funktionieren. Und jede Einordnung setzt einen politischen und ideologischen Rahmen.
Lehre Nummer 2: Welche Schwerpunkte setzen die Filme?
Jeder der drei Filme legt leicht andere Schwerpunkte. Einige Aspekte der Revolution wurden jedoch in allen drei Filmen stark betont. Daraus ergeben sich für mich zwei Schlüsse:
Erstens: Die kommunistische Bewegung in Russland war eine Anti-Kriegs-Bewegung. In allen drei Filmen spielt der erste Weltkrieg eine zentrale Rolle; seine Brutalität, und Erbarmungslosigkeit. Nach dem Schauen des Films vermutet man, dass ohne den ersten Weltkrieg die kommunistische Revolution nicht (so) erfolgreich gewesen wäre.
Zweitens: Die kommunistische Bewegung war eine Massenbewegung. Jeder der Filme stellt heraus, wie alle gemeinsam, zusammen, an diesem großen Projekt der kommunistischen Sowjetunion zusammengearbeitet haben. Die Tausenden Menschen aller Couleur, die durch die Straßen Petrograds marschieren, hinterlassen Eindruck.
Natürlich spielt dabei das Pathos eine Rolle: Die Massen, die Reden, die Musik sollten mich bewegen und das haben sie auch. Ich habe mitgefiebert. Am Ende von allen drei Filmen konnte ich nicht umhin, zu denken: Wir erschaffen hier gerade eine Utopie.
Lehre Nummer 3: Ein neues Verständnis der Geschichte
Die letzte Erkenntnis ist die wichtigste Erkenntnis: Lebendig zu sehen, wie sich die Russische Revolution abspielte, verändert mein Verständnis von ihr. Und von Geschichte an sich. Es ist eine Art Verständnis, die man nur gewinnen kann, wenn man dabei war. Oder, wie in meinem Fall, sich stundenlang Originalaufnahmen anschaut. Ich konnte die einzelnen Facetten der Revolution, die Begeisterung, die Menschlichkeit spüren.
Sonst liest man nur die immer gleichen Phrasen: Die Armut nahm überhand, das Volk fürchtete sich vor dem Krieg, die Bürger verachteten die Zarenfamilie. Auf einer Textebene ist es schwer, die Russische Revolution anders zu beschreiben. Aber das erklärt nicht, was dort wirklich passiert ist. Die Aufnahmen in diesen Filmen sind in echt geschehen. Die Menschen, die in die Kameras lachten und winkten, das waren echte Menschen.
Klar, die Dokumentarfilme sind zum Teil langwierig. Natürlich, der Kontext ist nicht immer klar. Aber: So war es damals eben auch. Die Russische Revolution war keine eindeutige Folge von kausal zusammenhängenden Ereignissen. Nein, sie war eine gesellschaftliche Entwicklung, aus tausenden kleinen Schritten zusammengesetzt. Historische Ereignisse werden nicht von den Königen, Zaren und Kriegsführern geschrieben. Sondern von den tausenden Menschen auf der Straße, die die Ungerechtigkeiten nicht mehr ertragen können. Und wenn sie von einem sowjetischen Experimentalfilmer eine Kamera ins Gesicht gehalten bekommen; ja, was dann? Dann lächeln und winken sie. Weil sie echte Menschen sind.